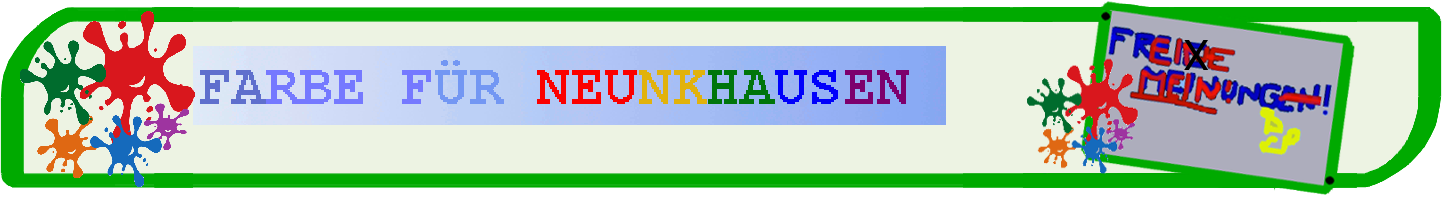Windenergieanlagen
Ein bisschen Theorie: Grundlagen und Begriffsklärung
Zum besseren Verständnis folgen zunächst einige Begriffsklärungen und Erläuterungen. Sie sollen auch mit der Windkraft noch nicht so vertrauten Lesern die Möglichkeit geben, die weiter unten durchgeführten Berechnungen einfach nachvollziehen zu können. Der Begriff Strom meint dabei z.B. die - umgangssprachliche damit verbundene - allgemeine Erzeugung bzw. Übertragung elektrischer Energie. Wissenschaftlich oder auch wirtschaftlich ausführlichere Beschreibungen findet der interessierte Leser in der einschlägigen Fachliteratur. Für alle, die diesen Abschnitt überspringen möchten, geht es hier direkt zu den Zahlen für lokale Windanlagen.
Vergütung für Windräder
Für den Betrieb eines Windrades wird dem Betreiber für jede erzeugte und in das öffentliche Netz eingespeiste Menge an Strom eine Vergütung gezahlt. Diese unterliegt bisher allerdings keiner echten marktwirtschaftlichen Regelung: Die Vergütung für jede erzeugte Kilowattstunde Strom ist vom Gesetzgeber "administrativ" festgelegt worden und wird für einen definierten Zeitraum sogar garantiert. Dies gilt unabhängig davon, wieviel Strom benötigt wird, wieviele Windräder aktuell gerade Strom produzieren und auch wenn die gezahlte Vergütung gerade über dem realen "Marktwert" für die Kilowattstunde liegt, d.h. vom Stromkunden bezuschusst wird. In Deutschland regelt das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Kurztitel Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG 2014, EEG 2017 und in der aktuellen Überarbeitung EEG 2021) die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Quellen und die damit verbundenen derzeit garantierten Einspeisevergütungen.
Aufgrund des in den letzten Jahren stark gestiegenen Strompreises für die (meist privaten) Stromkunden wurden bereits in diesem Jahr einige Änderungen an dem Gesetz durchgeführt. Weitere Korrekturen sollen folgen. Genauere Inhalte sind (Stand 2014) noch unklar und in der Abstimmung mit zum Teil erheblichen Auswirkungen auf aktuelle und auch zukünftige Windparks. Kernthema ist dabei der Ersatz der aktuell garantierten Vergütungsätze für Strom aus Windenenergieanlagen und anderen regenerativen Energiequellen durch mehr wettbewerbliche Elemente. So wird u.a. diskutiert, Windparks zukünftig auszuschreiben. Den Zuschlag - z.B. in öffentlichen Auktionen - soll dann z.B. der Anbieter mit den günstigsten Vergütungssätzen erhalten. Gleichzeitig wird diskutiert, dass Betreiber ihren erzeugten Strom entweder selbst oder über eine zentrale Stelle dann auch marktüblich anbieten müssen.
In Konsequenz befinden sich die einzelnen Windparkbetreiber dann im echten Wettbewerb zueinander und jeder Betreiber eines Windparks müsste sich zukünftig auch um die Abnahme seines erzeugten Stroms Gedanken machen. Die garantierten Preise für jede erzeugte Kilowattstunde Windstrom werden dann vermutlich durch den realen, deutlich niedrigeren "Marktwert" für Strom ersetzt werden.
Wie hoch ist derzeit der "Marktwert" für die Kilowattstunde Strom ?
Einen Hinweis darauf gibt die folgende Tabelle. Aus den gehandelten Terrawattstunden an Strom pro Jahr und dem dafür erzielten (Börsen)Preis über die European Energy Exchange AG (EEx), Energiebörse Leipzig, wurde ein durchschnittlicher Strompreis pro Jahr für den Zeitraum 2010 bis 2013 errechnet.
| European Energy Exchange AG (EEx) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Menge/Jahr | Summe/Jahr | Durchschnittspreis/Jahr | ||||
| 2010 | 205,51 TWh | 9,359 Mio € | 45,54 €/MWh | ||||
| 2011 | 224,55 TWh | 11,582 Mio € | 51,58 €/MWh | ||||
| 2012 | 245,27 TWh | 10,456 Mio € | 42,63 €/MWh | ||||
| 2013 | 245,57 TWh | 9,306 Mio € | 37,89 €/MWh | ||||
Die Tabelle zeigt sehr anschaulich, das Strom an der Börse im gezeigten Zeitraum - im Gegensatz zu den Endverbraucherpreisen für Strom - immer günstiger gehandelt wurde. 2013 betrug der Börsen- bzw. Marktwert für die Kilowattstunde Strom nur noch knapp 3,8 Cent/kWh.
Dazu noch eine wichtige Anmerkung: In den nachfolgenden Berechnungen wird als "Marktwert" jeweils der obige Durchschnittsatz pro Kilowattstunde und Jahr von der Leipziger Energiebörse eingesetzt. Diese Annahme geht allerdings davon aus, dass der Strom aus regenerativen Energien und konventioneller Energieerzeugung in Kraftwerken gleiche Preise am Markt erzielen kann. In der Regel wird dies aber nicht der Fall sein. Regenerative Energien schwanken - ohne die Möglichkeit einer Zwischenspeicherung - stark mit den aktuellen Wetterbedingungen. Deshalb laufen konventionelle Kraftwerke zur Absicherung im Hintergrund immer mit. Diese sind aber träge, d.h. sie können nicht beliebig schnell rauf oder runter gefahren werden. Wird nun plötzlich viel Windkraft erzeugt und in das Stromnetz eingespeist, kommt es in kurzer Zeit zu massiven Überkapazitäten an Strom im Netz.
Um diese nun kurzfristig wieder abbauen zu können, wird der zuviel produzierte Strom am Markt weiterverkauft, meist direkt ins Ausland. Aufgrund des nun vorhandenen Überangebots bei gleichbleibender Nachfrage sinkt aber auch der Preis: Im schlimmsten Fall fällt der Strompreis an Tagen mit starken Windstunden sogar negativ aus und der zuviel erzeugte Strom muss verschenkt bzw. sogar dafür noch Geld gezahlt werden, um ihn los zu werden. Damit liegt der gezahlte Preis für regenerativ erzeugten Strom in der Realität meist deutlich unter dem Preis für herkömmlichen Strom. Entsprechend höher ist dann auch die Differenz zwischen der fest gezahlten Vergütung und dem dann viel niedrigeren Marktwert für Strom aus Windenergie.
Ertrag und Auslastung
Zum besseren Verständnis stellen Sie sich die Stromerzeugung eines Windrades wie einen (klassischen) Dynamo am Reifen eines Fahrrades vor. Bei stehendem Fahrrad wird überhaupt kein Strom erzeugt. Bei langsamen Geschwindigkeiten erzeugt der Dynamo zwar Strom, aber nur so viel, dass die Beleuchtung am Fahrrad noch schwach leuchtet. Wird das Fahrrad nun schneller, wird das Licht ebenfalls heller. Zumindest solange, bis bei einer bestimmten Geschwindigkeit die maximal mögliche Lampenhelligkeit erreicht ist. Auch wenn das Fahrrad den Dynamo immer schneller antreibt, ändert sich die Beleuchtung dann nicht mehr. Ohne entsprechende Vorkehrungen kommt dann höchstens irgendwann der Punkt, wo das System überlastet wird und z.B. die Birne des Scheinwerfers doch noch durchbrennt.
Genauso funktioniert die Stromerzeugung eines Windrades. Statt des Fahrradreifens dreht der Wind die Rotoren und treibt damit einen Generator an. Damit das Windrad überhaupt Strom erzeugen kann, wird eine Mindestgeschwindigkeit des Windes benötigt. Von diesem Punkt an wird mit steigender Windgeschwindigkeit immer mehr Strom erzeugt, bis schließlich die maximal mögliche Leistung erreicht ist. Von nun an bleibt die erzeugte Menge an Strom immer gleich, egal ob die Rotoren noch schneller drehen oder nicht. Die Sicherungsmaßnahme gegen Durchbrennen der Lampe am Dynamo bei zu "wildem Fahren" ist für das Windrad das Abschalten bei Sturm: Bei zu hohen Windgeschwindigkeiten wird das Windrad vor einer Beschädigung mit seinen Rotorflächen aus dem Wind gedreht.
Der Anstieg der erzeugten Leistung in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit stellt ein wichtiges Auswahlkriterium für eine Windenergieanlage dar. Solche Datensätze werden in der Fachliteratur als Leistungskennlinie oder einfach nur als Anlagenkennlinie bezeichnet. Leistung meint dabei die Ausgangsleistung des Generators (und nicht die ebenfalls sehr oft angeführte Windleistung an den Rotorflügeln). Als Windgeschwindigkeit wird ebenfalls eine idealisierte mittlere Windgeschwindigkeit unter Normalbedingungen verwendet. Diese muss für eine Standort bezogene Rechnung erst noch an die realen Bedingungen vor Ort angepasst werden.
Die Maximalleistung in der Anlagenkennlinie wird auch als Nennleistung oder installierte Anlagenleistung bezeichnet. Damit eine Windenergieanlage diesen Wert liefern kann, müssen die Windverhältnisse die Rotoren des Windrades immer so schnell antreiben, das die Anlage unter Volllast (am oberen Ende der Anlagenkennlinie) arbeitet. Typischerweise wird dies bei Windgeschwindigkeiten zwischen 12 m/s und 15 m/s der Fall sein. In der Praxis gibt es solche Geschwindigkeiten in unseren Gegenden allerdings eher selten und solche stürmischen Wetterverhältnisse müssen eher durch Windstille oder Zeiten mit nur kleinen Windgeschwindigkeiten ersetzt werden. Das Windrad erzeugt in diesen Zeiten dann nicht die theoretisch installierte Leistung, sondern nur einen kleinen Bruchteil davon.
Für weitergehende Betrachtungen wird meistens nicht die Anlagenleistung verwendet, sondern direkt die Kilowattstunden an Strom, die ein Windrad zu einer vorgegebenen Anlagenleistung im Jahr überhaupt erzeugen kann. Die Berechnung dieses sogenannten Energieertrags ist recht einfach: Man multipliziert die Anlagenleistung mit den 8760 möglichen Stunden eines Jahres und erhält daraus dann direkt den Ertrag in Kilowattstunden pro Jahr. Eine mit 1000 kW Installationsleistung angegebene Anlage liefert so z.B. theoretisch bis zu 8760000 kWh pro Jahr, eine 2000 kWh Anlage maximal 17520000 kWh im Jahr, d.h. theoretisch genau doppelt so viele Kilowattstunden. Die genannten Maximalzahlen gelten dabei immer unter der Voraussetzung, dass die am Standort vorherrschenden Windgeschwindigkeiten so hoch sind, dass die Anlage auch im Volllastbetrieb arbeiten kann. Solche Werte werden in der Praxis allerdings nicht mal annähernd erreicht.
Eine Aussage über den tatsächlichen Ertrag eines Windrades gegenüber der Theorie liefert ein Vergleich der tatsächlich erreichten Summenleistung im Jahr ("Istwert") mit der theoretisch installierten Anlagenleistung im Jahr ("Sollwert"). Die sich ergebene Auslastung, als Quotient aus diesen beiden Werten, wird dann typischerweise in Prozent angegeben. Ein Wert von 100% entspricht dann der obigen Vollauslastung: D.h. die anhand der installierten Leistung maximal mögliche Anzahl Kilowattstunden wurde rund um die Uhr das ganze Jahr geliefert. 50% Ertrag bedeuten entsprechend, das eine Anlage im Schnitt nur die Hälfte der theoretisch möglichen Jahresmenge an Strom erzeugt bzw. in das Stromnetz eingespeist hat. Man spricht in diesem Zusammenhang auch vom Volllaststunden Äquivalent oder vom Kapazitätsfaktor. Es liegt für die meisten Windstandorte im nördlichen hohen Westerwald für neuere Anlagen typischerweise zwischen 15 und maximal 25 Prozent.
Neben der prozentualen Auslastung ist für einen Vergleich der Soll- und Istwerte für ein Windrad vor allem die Angabe Volllaststunden pro Jahr üblich. Dazu wird der gemessene Jahresenergieertrag (Kilowattstunden im Jahr) durch die Anlagenleistung geteilt. Das Beispiel der 1000 kWh Anlage unter Volllast z.B. liefert dann:
8760000 kWh pro Jahr / 1000 kW = 8760 h pro Jahr
Man sieht, dass die 100% Ertrag (bei Vollauslastung) nun 8760 Volllaststunden pro Jahr entsprechen. Bei 4380 Vollaststunden pro Jahr hat eine Anlage - rein rechnerisch - nur die Hälfte der Zeit diesen Strom geliefert, d.h. eine Auslastung von 50% gehabt.
Zum Vergleich: Windparks auf dem Meer liegen tatsächlich bei deutlich über 4000 Stunden/Jahr, gute Windparks an Land bei immer noch über 2000 Vollaststunden / Jahr.
Bestimmung der Windgeschwindigkeit
Normalerweise kann anhand der an einem Standort gemessenen Windverhältnisse zusammen mit der Anlagenkennlinie für einen bekannten Windradtyp der erwartete Jahresertrag bzw. die Auslastung abgeschätzt werden (siehe Anmerkungen im Kasten).
Mit gewissen Annahmen kann eine solche Berechnung auch "rückwärts" genutzt werden. D.h. aus der bekannten Produktionsmenge an Strom wird zunächst der Jahresertrag und daraus dann - zusammen mit der bekannten Anlagenkennlinie - auf die Windverhältnisse am Standort des Windrades geschlossen.
Häufigkeitsverteilung und mittlere Windgeschwindigkeit
Die Anlagenkennlinie ist wie beschrieben eine Tabelle, in der die maximal mögliche Ausgangsleistung einer Anlage in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit aufgetragen ist. Eine solche Tabelle wird meist pauschal für einen bestimmten Anlagentyp vom Anlagenhersteller bereitgestellt. Dabei enthält der meist theoretische Kurvenverlauf verschiedene Vereinfachungen, die so in der freien Natur nicht vorkommen. So schwankt vor allem "echter" Wind z.B. ständig in der Geschwindigkeit und hat keinen erfassbaren Einzelwert.
In der Praxis wird für wirklich seriöse Aussagen zum Stromertrag zunächst die mittlere Windgeschwindkeit zusammen mit den Schwankungen der Windgeschwindigkeit vor Ort exakt vermessen. Üblicherweise misst man dazu mit einem Windmessgerät (Anemometer) über einen größeren Zeitraum und möglichst verteilt über das gesamte Jahr die mittlere Windgeschwindigkeit für verschiedene Höhen. Die so bestimmten Werte ordnet man dann in sogenannte Windgeschwindigkeitsklassen ein, die einen Bereich von meist 1 m/s umfassen. Der Energiegehalt des Windes an einem Standort lässt sich nun durch die sich ergebende Häufigkeitsverteilung dieser Windgeschwindigkeitsklassen ausdrücken.
In vielen Fällen wird eine so gemessene Verteilung der Windgeschwindigkeit mathematisch durch eine sogenannte Weibull-Verteilung mit den 2 Parametern A und k wiedergeben: Der Skalierungsfaktor A ist proportional zum (gemessenen) Mittelwert der Windgeschwindigkeit, der Formfaktor k beschreibt die Form der Verteilung. Kleine k-Wert bedeuten dabei sich häufig ändernde Winde, während gleichbleibende Winde einen großen k-Wert ergeben. Übliche Werte für k liegen im Bereich zwischen 1 und 3, für die meisten theoretischen Betrachtungen - ohne entsprechende Messungen - wird überwiegend mit einem mittleren k-Wert von 2 gerechnet.
Der resultierende (ausgangsseitige) Ertrag des Windrades in Abhängigkeit von der gemessenen mittleren Windgeschwindigkeit ergibt sich nun durch Multiplikation (mathematisch: durch "Faltung") der beiden Kurven (gemessene) Windgeschwindigkeitsverteilung und Anlagenkennlinie.
Am Boden wird der Wind allerdings sehr stark durch das Landschaftsprofil beeinflusst. Wald, Häuser und andere größere Landschaftsunebenheiten im Umfeld von Windanlagen schwächen die Windgeschwindigkeit ab und mindern so den Stromertrag eines Windrades zum Teil erheblich. Je größer der Abstand zur Erdoberfläche ist, desto kleiner wird auch der Einfluss der Umgebung auf den Wind: Die Windgeschwindigkeit nimmt mit steigender Höhe zu.
Schließt man aus der Stromproduktion zurück auf die mittlere Windgeschwindigkeit, so gilt diese zunächst nur für die Nabenhöhe des zugrunde gelegten Windrades. Für andere Nabenhöhen muss dieser Wert dann entsprechend angepasst werden. Dafür sind verschiedene mathematische Modelle im Umlauf, wie z.B. das logarithmische Windprofil (nur für flaches Gelände ohne größere Verwirbelungen). Damit lässt sich dann bei bekannter Windgeschwindigkeit für eine bestimmte Höhe auch die Windgeschwindigkeit in anderen Höhen bestimmen. In diese Berechnung geht z.B. die Luftdichte aber vor allem auch das Landschaftsprofil ein. Dazu werden die verschiedenen Geländeoberflächen in sogenannte Rauigkeitsklassen eingeteilt und mit zugehörigen Korrekturfaktoren im Windprofil näherungsweise berücksichtigt. Glatte Wasseroberflächen haben dabei typischerweise die niedrigste Rauigkeitsklasse, Wälder ebenso wie sehr raues, unebenes Gelände die zweithöchste Klasse, nur noch übertroffen von der höchsten Klasse für Hochhäuser.
Weiterhin ist zu beachten, dass die Bestimmung der Windgeschwindigkeit aus dem Jahresertrag nur dann korrekte Ergebnisse liefern kann, wenn es keine größeren Anlagenausfälle aufgrund technischer Probleme im überwachten Zeitraum gab. Ansonsten sind die gemessenen Erträge zu klein und damit auch die zurück gerechnete Windgeschwindigkeit zu gering. Genauen Aufschluss darüber können nur die zu einer Anlage geführten Überwachungsprotokolle geben. In der Regel sind diese Protokolle allerdings nicht jedem zugänglich und die Ausfälle müssen anderweitig abgeschätzt werden. Dazu bieten sich mehrere Wege an.
Bei mehreren Anlagen in einem Gebiet und Erträgen über mehrere Jahre ist zunächst eine Prüfung der einzelnen Ergebnisse zueinander möglich. So sind Abweichungen einer einzelnen Anlage gegenüber allen anderen in einem Jahr, z.B. ein deutlich niedrigerer Ertrag, während alle anderen Anlagenerträge im gleichen Jahr gestiegen sind, ein Zeichen, dass tatsächlich ein Anlagenstillstand den Ertrag beeinflusst hat. Sind die Abweichungen der Anlagen zueinander dagegen über alle Jahre ähnlich, so ist vermutlich auch der Ertrag ohne größere Korrekturen nutzbar.
Permanent hohe Anlagenausfälle aufgrund grundlegender bautechnischer Probleme einer ganzen Serie über die gesamte Laufzeit kann man dabei ausschliessen. Sie wären entweder bereits zu Beginn der Installation direkt durch den Hersteller nachgebessert worden oder über entsprechende Berichte oder sogar mit einen vorzeitigen Abriss einer Anlage sichtbar geworden. Besser stellt sich die Situation dar, wenn in einem Gebiet sogar unterschiedliche Anlagentypen mehrfach verfügbar sind: Typspezifische Ausfälle lassen sich dann durch eine getrennte Bestimmung der Windgeschwindigkeit für jeden einzelnen Anlagentyp komplett ausschliessen.
Technisch bedingte Anlagenausfälle lassen sich in Form einer "worst case" Abschätzung aber auch direkt in der Rechnung berücksichtigen. Dazu folgende Überlegung: Für den Dauerbetrieb ausgelegte Anlagen werden bereits von Herstellerseite unter dem Gesichtspunkt einer maximalen Verfügbarkeit entwickelt und beworben. Schließlich garantiert eine hohe Verfügbarkeit mit geringen Ausfallzeiten dem späteren Käufer auch bessere Einnahmen bei niedrigeren Gesamtkosten und ist damit ein wichtiges Verkaufsargument gegenüber der Konkurrenz. In der Regel werden solche Zeiten dann auch - mit evtl. Sicherheitsabschlägen und weiteren Festlegungen zu Reaktionszeiten o.ä. versehen - in nachfolgende Liefer- oder Kreditverträge übernommen. Die Größenordnung der Verfügbarkeit hängt dabei stark von Branche und der Anlagenart ab. Eine "just in time" arbeitende Automobilfertigung mit vielen Serienelementen wird hier deutlich höhere Anforderungen haben und auch erreichen, als z.B. Sondermaschinen, die in regelmässigen Abständen gereinigt bzw. in Teilen ersetzt werden müssen. Windenergieanlagen zählen dabei prinzipbedingt eher zu den auf Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb ausgelegten Anlagentypen und dürften damit typischerweise eher eine hohe Verfügbarkeitsanforderung aufweisen.
Durch technische Defekte hervorgerufene Ausfälle in der Stromerzeugung eines Windrades lassen sich nun entweder direkt über die maximale Ausfallzeit oder - wenn nicht bekannt - durch Annahme einer solchen Ausfallzeit pro Jahr berücksichtigen. Bezogen auf die 8760 Gesamtstunden, in denen ein Windrad im Jahr bestenfalls überhaupt Strom produzieren kann, ergibt sich ein (prozentualer) Korrekturwert, mit dem dann sowohl der gemessene Ertragswert als auch die Volllaststunden im Jahr nach oben korrigiert werden. Daraus kann dann die korrekte Windgeschwindigkeit bestimmt wird. Zu beachten ist dabei, das die Verfügbarkeit einer Anlage - ohne entsprechende andere explizite Berücksichtigung in der Rechnung - streng genommen in alle gerechneten Anlagenerträge einfliessen muss. Bei Rechnungen mit bekannter Windgeschwindigkeit dann sogar als negativer Faktor, d.h. die im Jahr erzeugten Kilowattstunden sind am Ende entsprechend nach unten zu korrigieren.
Geht man davon aus, dass alle Anlagen - egal ob alt oder neu und absolut gesehen - in etwa gleiche Ausfallzeiten durch Defekte aufweisen (neuere Anlagen durch immer komplexere Elektronik dabei tendenziell sogar eher mehr als ältere Anlagen) werden die Unterschiede für zwei Anlagen mit und ohne Korrektur im Wesentlichen durch die Kennlinien und die installierte maximale Leistung bestimmt werden. Anlagen mit einem höheren Ertragswert bei einer bestimmten Windgeschwindigkeit verlieren absolut gesehen auch mehr Kilowattstunden pro Zeiteinheit, als Anlagen mit deutlich niedrigerem Ertrag bei dieser Windgeschwindigkeit.
In der Berechnungen der Windgeschwindigkeit aus dem Ertrag sind "worst case" Ausfallzeiten zwischen 5 und 10% der Jahressumme mehr als ausreichend. Realistisch erscheinen dabei eher 2% bis maximal 5%: Bei 8760 Stunden im Jahr entsprechen 5% Ausfall bereits einer Defektzeit von über 400 Stunden oder knapp 18 Tagen im Jahr, 10% dann bereits weit mehr als einem Monat Stillstand durch Defekt. Bei der im WEA Bereich üblichen Online Überwachung und Reaktionszeiten von wenigen Stunden ist dies ein eher unwahrscheinlicher Praxiswert.
Die in letzter Zeit immer öfters diskutierten phasenweisen Abschaltungen von WEA zur Stabilisierung des Stromnetzes oder aufgrund fehlender Abnahmekapazitäten zählen dabei real nicht zu den technisch bedingten Anlagenausfällen. Ursache und Wirkung einer solchen Abschaltung sind identisch mit zu kleinen Windgeschwindigkeiten: Der gewählte Anlagenstandort lässt eine effektive Nutzung aufgrund fehlender Resourcen nicht zu und der theoretisch ermittelte Ertragswert im Jahr ist in der Praxis nicht erreichbar: Die Anlage ist eine Fehlinvestition, die durch den Stromkunden gestützt werden muss.